Mediathek
Herzlich willkommen in unserer neuen Mediathek!
Die Web-Seiten des Vereins für die Geschichte Berlins e.V. bieten eine Fülle wissenswerter Informationen – aktuell zudem ein neues digitales Medien-Portal: Unsere Mediathek!
Das gesellschaftliche Leben ist seit einem Jahr deutlich eingeschränkt. Die persönlichen Begegnungen anlässlich unserer beliebten Veranstaltungen und Vorträge durften seither nicht mehr stattfinden. Für den VfdGB-Vorstand ein besonderer Grund, seine erfolgreiche Kulturarbeit zur Erforschung der Stadtgeschichte durch eine Mediathek zu ergänzen, in die sich gerne sämtliche Mitglieder mit interessanten Ideen, aber auch mit ihrer eigenen Geschichte oder die ihrer Eltern und Großeltern einbringen sollten.
Mit gutem Beispiel ging der Vorsitzende Dr. Manfred Uhlitz voran. Er veröffentlichte in den Mitteilungen, Heft 1/2021 einen familiären „Briefschatz“ aus der entbehrungsreichen Nachkriegszeit. Die ersten vier Berichte aus diesem persönlichen Briefzyklus wurden nunmehr von Alexandra Hansen-Bingas eingelesen - einfühlsam und zugleich emotional. Schon mit dieser einleitenden Folge präsentiert unsere Mediathek ein spannendes und authentisches Hörerlebnis!
Angedacht ist eine Erweiterung des Erinnerungsrepertoires, bspw. mit Videos und Tondokumenten. Übermitteln Sie uns bitte gerne Ihre Vorschläge und Meinungen.
Berlin, 19.03.2021 - Mathias C. Tank
Pressesprecher des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865
Willy Pragher - Weltstadt am Abgrund, Berlin in Fotografien 1926 - 1939
Wir waren bei der Vorstellung des Bildbandes, Willy Pragher - Weltstadt am Abgrund, Berlin in Fotografien 1926 - 1939, mit der Kamera dabei. Der Autor und Herausgeber Lothar Semmel berichtet, wie er an den Fotografen und seine Bilder gekommen ist. Der Verleger berichtet von einer fruchtbaren Kooperation.
Autorin des Films ist das Vorstandsmitglied Ilona Wuschig
Spandau – die heimliche Hauptstadt des Havellandes
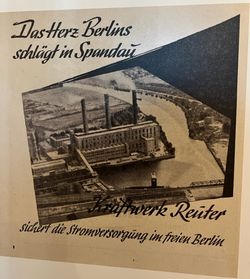 „Spandau – die heimliche Hauptstadt des Havellandes“, ein bebilderter Vortrag von Dr. Urte Evert, Leiterin des Stadtgeschichtliches Museums Spandau.
„Spandau – die heimliche Hauptstadt des Havellandes“, ein bebilderter Vortrag von Dr. Urte Evert, Leiterin des Stadtgeschichtliches Museums Spandau. Ilona Wuschig im Gesräch mit Urte Evert
Mittwoch, 14. Juni 2023, 19:00 Uhr
Berlin-Saal der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 10178 Berlin, Breite Straße 36
Ein Jahr vor der Eingemeindung Spandaus in die Stadt- und Einheitsgemeinde Groß-Berlin wehrten sich insbesondere Spandauer Politiker und Magistratsmitglieder vehement gegen die Vereinnahmung ihrer florierenden Stadt. Aus der außerordentlichen Generalversammlung des Wahlvereins der Spandauer SPD vom 26. Juli 1919 erging der Ausruf „Spandau passt seiner ganzen Konstruktion nach viel eher zum Kreise Osthavelland!“ Auch nach der Eingemeindung blieb die Hinwendung zum Havelland intensiv, bis die Mauer den Kontakt brutal beschnitt. Seit 1990 ist die Beziehung zwischen Spandau und Brandenburg wieder dynamisch und lebendig. Im Vortrag wird die historische mit der gegenwärtigen Entwicklung gespiegelt und zur Diskussion gestellt.
2. Mai 1883 - Der Geburtstag des blinden Nazi-Widerständlers Otto Weidt
WDR ZeitZeichen vom 02.05.2023 - Von Claudia Belemann
Otto Weidt war Anarchist, Besitzer einer Blindenwerkstatt, seit 1940 selbst blind - und mutiger Widerständler gegen die Nazis. Der Berliner setzte sein Leben aufs Spiel, um jüdische Mitmenschen zu retten.
Otto Weidt betrieb eine Blindenwerkstatt in Berlin. Sie ist heute ein Museum, denn von hier aus organisierte er die Unterstützung und Rettung zahlreicher Berliner Juden und Jüdinnen während der Nazizeit. Mit Geschick und Bestechungsgeldern machte der überzeugte Pazifist die Blindenwerkstatt zu einem "wehrwichtigen Betrieb" im Zweiten Weltkrieg und konnte seine jüdischen Mitarbeiterinnen lange vor der Deportation schützen. Er organisierte die Übersendung von Lebensmittelpaketen ins Ghetto Theresienstadt, versteckte selbst eine Familie und brachte andere in weiteren Verstecken unter. Nach dem Krieg setzte sich Otto Weidt für den Bau eines jüdischen Waisenhauses und eines Altenheims für KZ-Überlebende ein.
Er selbst starb bereits 1947 im Alter von 64 Jahren. Seit 1971 ist Otto Weidt offiziell ein "Gerechter unter den Völkern". Dieser israelische Ehrentitel wird an Einzelpersonen verliehen, die während der Zeit des Holocaust ihr Leben riskierten, um jüdische Mitmenschen zu retten. Es gibt ein Ehrengrab des Landes Berlin für ihn, aber seine Geschichte ist erstaunlich unbekannt.
Die Geschichte des Alexanderplatzes
Vom Viehmarkt zum urbanen Stadtplatz: Der Alexanderplatz in Berlin Mitte. Rund um den sich ständig im Wandel befindlichen Platz gibt es viele Denkmale, die den Passantinnen und Passanten die wechselvolle Geschichte dieses Ortes bei genauem Hinblicken näherbringen. In diesem Film werden sie gezeigt und erklärt: Die Königskollonaden von 1780, die sich seit 1909 im Kleistpark in Schöneberg befinden, die Behrensbauten von 1931, und die vielen Denkmale der DDR-Zeit, die für die Umgestaltung des Platzes in den 1960er Jahren stehen. Zum wohl bekanntesten Denkmal auf dem Alexanderplatz, der Weltzeituhr, verrät Designer Erich John in einem Interview spannende Details, was den Entwurf die Errichtung angeht.
Das Landesdenkmalamt Berlin auf YouTube
Das Landesdenkmalamt Berlin im Internet: www.berlin.de/landesdenkmalamt/
Die Lange Brücke in Alt-Berlin
Von Joachim Brunold, Beitrag auf YouTube
Als zweite Verbindung zwischen den Städten Cölln und Berlin wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Lange Brücke gebaut. Lang wurde sie genannt, weil sie neben dem Lauf der Spree auch den sumpfigen Uferstreifen vor Alt-Berlin überbrücken musste (die Burgstraße existierte noch nicht) und sie deshalb 14 Joche aufwies.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Steinbrücke aufgeführt, wurde sie, weil König Friedrich I das Denkmal des Großen Churfürsten auf ihr aufstellen ließ, in Churfürstenbrücke umbenannt.
Im 2. Weltkrieg von der Wehrmacht zerstört, wurde sie als Notbrücke wieder aufgebaut und 1951 zur Rathausbrücke umgewidmet. Diese Brücke diente bis 2009 als Spreeübergang.
Im Film wird neben der Brücke auch ein Blick auf Häuser und Bewohner im Umfeld geworfen.
Berlin, der Müll und die Nationalsozialisten
Geschichte der Stadtreinigung
Beitrag auf Deutschlandfunk Nova Hörsaal vom 20. Januar 2023 | Moderation: Katja Weber | Vortragender: Sören Flachowsky, IZWT, Bergische Universität Wuppertal
Wo viele Menschen eng zusammenleben, muss die Müllentsorgung geregelt sein. Der Historiker Sören Flachowsky hat erforscht, wie sich die private Müllentsorgung in Berlin hin zu einer kommunalen Dienstleistung entwickelt, wie sich der Müll im Verlauf der Jahrzehnte verändert und wie sich die Berliner Stadtreinigung im Nationalsozialismus verhalten hat.
Wie auch in anderen Städten entwickelt sich auch in Berlin eine geregelte Müllabfuhr nur langsam. Bis ins 19. Jahrhundert hinein stapeln die Einwohner ihren Müll in den Höfen oder sie schmeißen ihn auf die Straße. In unregelmäßigen Abständen wird er von privaten Fuhrbetrieben abgeholt und zwar in offenen Wagen, erzählt Sören Flachowsky in seinem Vortrag.
Sören Flachowsky ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung (IZWT) der Bergischen Universität Wuppertal. 2021 erschien seine Forschungsarbeit zur Berliner Stadtreinigung in Buchform unter dem Titel "Saubere Stadt. Saubere Weste? Geschichte der Berliner Stadtreinigung von 1871 bis 1955 mit dem Schwerpunkt Nationalsozialismus".
Seinen Vortrag mit dem Titel "Nicht nur Saubermänner! Die Berliner Stadtreinigung im Nationalsozialismus" hat er am 5. Mai 2022 im Einstein Forum Potsdam gehalten.

