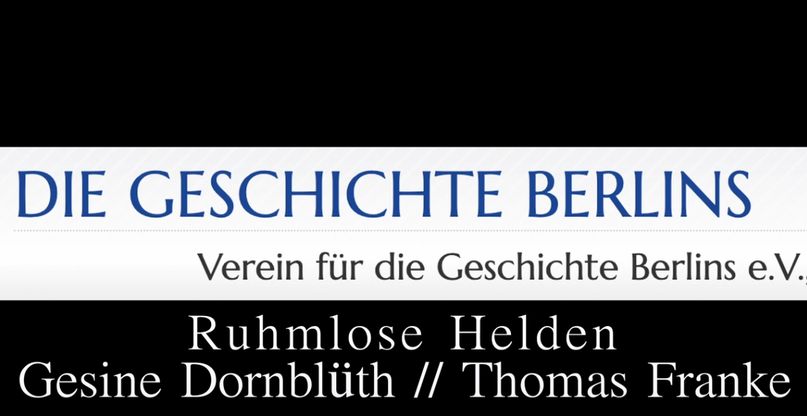Mediathek
Herzlich willkommen in unserer neuen Mediathek!
Die Web-Seiten des Vereins für die Geschichte Berlins e.V. bieten eine Fülle wissenswerter Informationen – aktuell zudem ein neues digitales Medien-Portal: Unsere Mediathek!
Das gesellschaftliche Leben ist seit einem Jahr deutlich eingeschränkt. Die persönlichen Begegnungen anlässlich unserer beliebten Veranstaltungen und Vorträge durften seither nicht mehr stattfinden. Für den VfdGB-Vorstand ein besonderer Grund, seine erfolgreiche Kulturarbeit zur Erforschung der Stadtgeschichte durch eine Mediathek zu ergänzen, in die sich gerne sämtliche Mitglieder mit interessanten Ideen, aber auch mit ihrer eigenen Geschichte oder die ihrer Eltern und Großeltern einbringen sollten.
Mit gutem Beispiel ging der Vorsitzende Dr. Manfred Uhlitz voran. Er veröffentlichte in den Mitteilungen, Heft 1/2021 einen familiären „Briefschatz“ aus der entbehrungsreichen Nachkriegszeit. Die ersten vier Berichte aus diesem persönlichen Briefzyklus wurden nunmehr von Alexandra Hansen-Bingas eingelesen - einfühlsam und zugleich emotional. Schon mit dieser einleitenden Folge präsentiert unsere Mediathek ein spannendes und authentisches Hörerlebnis!
Angedacht ist eine Erweiterung des Erinnerungsrepertoires, bspw. mit Videos und Tondokumenten. Übermitteln Sie uns bitte gerne Ihre Vorschläge und Meinungen.
Berlin, 19.03.2021 - Mathias C. Tank
Pressesprecher des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865
Kriegsnarben in Pflastersteinen
Erschienen am 11. Oktober 2025 auf Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.
Jede Folge ist ein kleines Mosaiksteinchen im großen kulturellen Ganzen der Stadt, keine Folge gleicht der anderen, einige sind ganz kurz, andere länger, von Berlinbuch-Vorstellungen über Kulturspaziergänge und Hörspiele bis hin zu Lesungen, Features, Reportagen und Interviews. Von und mit Marc Lippuner
In der 115. Folge seines Berlin-Kultur-Podcasts trifft Marc Lippuner einen ungewöhnlichen Spurensucher: Hans Greiner, der sich selbst Elohans nennt, dokumentiert Kriegsspuren im Berliner Straßenbild – von Einschusslöchern in Hauswänden bis hin zu Frakturen im Straßenpflaster. Welche Erkenntnisse lassen sich aus den beschädigten Steinen herauslesen? Wie werden die Berliner Gehwegplatten zu Zeugnissen der Geschichte – und warum werden sie eigentlich Schweinebäuche genannt? Hans Greiner erzählt, was ihn antreibt, wie ihn sein Weg vom Ingenieur zum akribischen Feldforscher führte, warum ihn die Suche nach den noch sichtbaren Spuren des Zweiten Weltkriegs im Berliner Straßenland nicht mehr loslässt und wie aus einem scheinbaren Hobby eine Mission wurde. und was andere aus seiner Arbeit machen könnten. Ein leidenschaftliches Plädoyer für den Blick nach unten.
Website von Hans Greiner mit den dokumentierten Kriegsspuren: www.elohans.selfhost.co
Der Artikel von Armin Fuhrer in der Berliner Zeitung vom 23. August 2025: Auf Spurensuche in Berlin. Der Mann, der mit den Steinen redet
Die Hugenotten im Umkreis Berlins
Von Aaron Mundhenk, Schüler des Europäischen Gymnasiums Bertha-von-Suttner in Berlin-Reinickendorf
Das Hörbuch entstand im Rahmen des Geschichtswettbewerbs 2024/25 welcher das Thema: Bis hierhin und nicht weiter!? Grenzen in der Geschichte behandelte.
 Abb.: Relief von Johannes Boese, 1885: Der Große Kurfürst begrüßt ankommende Hugenotten
Abb.: Relief von Johannes Boese, 1885: Der Große Kurfürst begrüßt ankommende Hugenotten
Ursprung unbekannt, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=874950
Das Hörbuch behandelt das Thema der Integration der Hugenotten im Umkreis Berlin vom 17. bis 18. Jhr.
Es geht speziell darum, ob und wie die Hugenotten damals integriert wurden und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Hugenotten in das Berliner Leben zu integrieren und welche Hürden dabei überwunden werden mussten. Im Hörbuch werden die Geschehnisse sowohl direkt durch die Augen von damaligen Bürgern dargestellt, als auch über die Hintergründe der Hugenotten informiert.
Wissen, wo wir herkommen: Der Verein für die Geschichte Berlins
Beitrag auf rbb24 - InfoRadio vom 5. März 2024
Heute wurde der Verein für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865 (kurz: VfdGB), durch den Vorsitzenden Dr. Manfred Uhlitz im Haus des Rundfunks vorgestellt. Dr. Uhlitz konnte während des Interviews mit dem rbb-Hörfunk-Redakteur Harald Asel u.a. über die Historie des VfdGB sowie über dessen vielfältiges Engagement berichten.
Der Berliner Statistiker Richard Böckh
Zum Vortrag am Mittwoch, 27. März 2024, 19:00 Uhr
Vortrag und PowerPoint-Präsentation von und mit Professor Dr. Torsten Leuschner, Universität Gent am Vorabend der 200. Wiederkehr seines Geburtstags.
Berlin-Saal der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 10178 Berlin-Mitte, Breite Straße 36
Nach dem Studium der Staatswissenschaften und einer Beamtenkarriere begleitete Böckh von 1875 bis 1903 als Direktor des Statistischen Bureaus der Stadt Berlin die intensivste Phase des Wachstum Berlins. Daneben war er Stadtverordneter in Charlottenburg und Honorarprofessor an der Berliner Universität, wo Ferdinand Tönnies und Robert Kuczynski seine prominentesten Schüler waren. Um 1900 galt er als der wichtigste deutsche Statistiker. Sein Nachlass in der Staatsbibliothek Berlin enthält zahlreiche Ehrungen, aber auch manche bemerkenswerten persönlichen und beruflichen Zeugnisse.
Statistik interessiert Sie nicht? Macht nichts, denn der Lebenslauf und die Werke des Berliner Statistikers Richard Boeckh sind für jede und jeden interessant. Unser Referent, Professor Dr. Torsten Leuschner von der Universität Gent, ist von Hause aus Linguist. Wie er auf den Statistiker Boeckh stieß auch das berichtet er am Vorabend von Boecks 200sten Geburtstags.
Alle Beiträge aus unserem Adventskalender 2023
 In unserer Podcast Reihe „Berliner Adventskalender – Momente einer großen Stadt“ konnten Sie vom 1. bis zum 26. Dezember jeden Tag ein Hör-Türchen öffnen. Hinter jedem Türchen erfahren Sie in 10 bis 15 Minuten Neues, selbst, wenn Sie die Stadt und Ihre Geschichte gut kennen. Unsere Experten und Expertinnen decken verschiedene Bereiche und Zeiten ab – vom erstaunlichen Fund der ersten Berliner, über technische Neuerungen und Erfinderinnen, bis Literaten und Großkritikern und zum Ski-Weltcuprennen am Teufelsberg. Im Nachfolgenden können Sie alle Beiträge noch mal nachhören.
In unserer Podcast Reihe „Berliner Adventskalender – Momente einer großen Stadt“ konnten Sie vom 1. bis zum 26. Dezember jeden Tag ein Hör-Türchen öffnen. Hinter jedem Türchen erfahren Sie in 10 bis 15 Minuten Neues, selbst, wenn Sie die Stadt und Ihre Geschichte gut kennen. Unsere Experten und Expertinnen decken verschiedene Bereiche und Zeiten ab – vom erstaunlichen Fund der ersten Berliner, über technische Neuerungen und Erfinderinnen, bis Literaten und Großkritikern und zum Ski-Weltcuprennen am Teufelsberg. Im Nachfolgenden können Sie alle Beiträge noch mal nachhören.
Die Podcast Gastgeberinnen sind: Ilona Wuschig, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, Journalistin, Kommunikations-wissenschaftlerin und Autorin und Alexandra Hansen-Bingas, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, Juristin und Seminarleiterin.
Das Hintergrundbild in unserem Kalender zeigt den Weihnachtsmarkt von 1796 in der Breite Straße (Reproduktion aus der Zeitschrift "Berliner Leben" von 1906 zum Thema "Weihnachten in Berlin vor 100 Jahren). Wir sehen einen Stich von J.S.L. Halle nach einer Zeichnung von Johann David Schleuen (Mi- B 1675), Detailvergrößerung (Mi- B 1384). Quelle - Fotoarchiv des VfdGB.
1.12.: Der Apotheker und Chemiker Martin Heinrich Klaproth entdeckt Uran und Zirconium.
Martin Heinrich Klaproth wurde am 1. Dezember 1743 geboren. Klaproth war Apotheker und Chemiker. Er entdeckte die Elemente Uran und Zirconium.
Unser Experte, Matthias Wolski, Mitglied im Verein für die Geschichte Berlin, ist ebenfalls Apotheker.
---
2.12. Die spektakulären Ausgrabungen am Petri-Platz verändern das Wissen über die ersten Berliner.
Über die ersten Berliner weiß man mehr, seit der spektakulären Ausgrabungen am Petri-Platz in Berlin Mitte. Die Radiocarbonuntersuchung der Skelette ergab erstaunliche Ergebnisse.
Unser Expertin, Claudia Melisch, Mitglied im Verein für die Geschichte Berlin, ist die Grabungsleiterin am Petriplatz.
---
3.12. Der große jüdisch-berliner Philosoph und Aufklärer Moses Mendelssohn braucht Freunde.
Moses Mendelssohn war – zusammen mit seinen Freunden Gotthold Ephraim Lessing und dem Verleger Friedrich Nicolai – das „Dreigestirn“ der Aufklärung. Er war auch – ein jüdischer Berliner.
Unser Experte, Walter Kreipe, Mitglied im Verein für die Geschichte Berlin, ist Verlagslektor und Gymnasiallehrer und bietet Stadtführungen zum Thema.
---
4.12. Der Ski-Weltcup am Teufelsberg … begründet keine Tradition.
Berlin war einer der Hotspots des Wintersports, inklusive Ski-Weltcup. Das hatte wenig mit geeigneten Hängen, aber viel mit dem Wettbewerbe der beiden Teilstädte Ost- und West-Berlin zu tun.
Unser Experte, Andreas Ulrich, ist Autor, Sportfan, Sportreporter und -moderator.
---
5.12. Die Aktion „Butterspende“ für alle Ostberliner über 60 endet.
Von 23. November bis Anfang Dezember 1953 gab es die Aktion „Butterspende“. Alle Ostberliner über 60 konnten sich ein Pfund „Ami“-Butter abholen.
Unser Expertin, Urte Evert, ist Museumsleiterin der Zitadelle in Berlin-Spandau.
---
6.12. Wo waren die ersten Berliner Weihnachtsmärkte.
Weihnachtsmärke fanden zu – fast – allen Zeiten statt, auch direkt nach großen Kriegen. Aber wo lagen die ersten Berliner Weihnachtsmärkte.
Unser Experte, Benedikt Goebel, ist Historiker und Stadtforscher.
---
7.12. Die Sing-Akademie wird wieder Eigentümerin ihres Stammhauses.
2012 entschied der Bundesgerichtshof, dass die Sing-Akademie, die älteste gemischte Chorvereinigung der Welt, Eigentümerin des „Hauses am Kastanienwäldchen" ist.
Unser Experte Christian Filips, ist Programmleiter und Dramaturg für die Sing-Akademie zu Berlin.
---
8.12. Der Kritiker Ludwig Rellstab verfasst ein Buch mit Weihnachtswanderungen durch das Berlin seiner Zeit.
Ludwig Rellstab war Mitte des 19ten Jahrhunderts der Kritiker Berlins. Doch der Autor der Vossischen Zeitung verfasste auch Weihnachtswanderungen durch das Berlin seiner Zeit.
Unsere Expertin, Bärbel Reißmann, ist Leiterin der Sammlung Theater am Stadtmuseum Berlin.
---
9.12. Egon Erwin Kischs neues Buch ist DAS Thema im Romanischen Café.
Gesprächsthema im Romanischen Café im Dezember 1925 ist Egon Erwin Kischs neues Buch „Der rasende Reporter“. Wer war dieser Kisch, der nicht in Berlin, sondern in Prag geboren wurde.
Unser Experte, Christian Buckard, ist Autor des Buchs „Egon Erwin Kisch: Die Weltgeschichte des rasenden Reporters„.
---
10.12. Goethe will einen der berühmtem Feilner-Ofen aus Berlin – und bekommt keinen.
Nachts gibt es einen Schwelbrand in Goethes Salon in Weimar. Er braucht endliche einen der Feilner-Ofen aus Berlin.
Unser Experte, Jan Mende, ist Ausstellungsmacher und Kurator des Museums Knoblauchhaus.
---
11.12. Die Ost-Berliner Aktiengesellschaft Bewag soll endlich Volkseigentum werden.
Am 11.12. bekommt der Ost-Berliner Bürgermeister einen Brandbrief. Die Aktiengesellschaft Bewag soll endlich Volkseigentum werden.
Unser Experte, Timothy Moss, ist Gastprofessor an der Humboldt-Universität.
---
12.12. Mit dem Streit zwischen einem Wassermüller und Friedrich II von Preußen beginnt die Gewaltenteilung.
1770 wurden erste Schritte in Richtung „Gewaltenteilung“ gegangen – im Streit zwischen dem Wassermüller Arnold und Friedrich II von Preußen.
Unser Experte, Dietmar Peitsch, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Jurist und Autor.
---
13.12. Die Royal Air Force in Gatow rettet Leben mit einem modernen Flugleitradar.
Ein Bericht in der Standortzeitung „Air Line“ der Royal Air Force Station Gatow beschreibt den moderne Flugleitradar, der in der Luftbrücke eine entscheidende Rolle spielen wird.
Unsere Expertin, Doris Mueller-Toovey, ist Leiterin der Neukonzeption de Militärhistorisches Museums der Bundeswehr Gatow.
---
14.12. Der Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld und seine Wirkung auf queere Communities.
Mit dem Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld begann die homosexuelle Emanzipations-Bewegung. Als Jude musste er Berlin verlassen, doch die queere Communities beziehen sich bis heute auf ihn.
Unser Experte, Jan Wilkens, hat in Deutschland und Israel zu jüdischer und queerer Geschichte studiert.
---
15.12. Der Anwalt Walter Linse wird spektakulär aus West-Berlin in den Osten entführt.
Die DDR hält den Anwalt Walter Linse für einen Top-Spion und entführt ihn spektakulär aus West-Berlin. Am 15.12. wird er im Moskauer Butyrka-Gefängnis hingerichtet.
Unser Experte, Dietmar Peitsch, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Jurist und Autor.
---
16.12. Der jüdischer-berlinische Unternehmer Siegfried Hirschmann produziert die Kabel für die Elektrifizierung Berlins.
Berlin wird elektrifiziert. Die Elektrifizierung braucht Kabel – vom Telefon bis zur Industrieproduktion. Siegfried Hirschmann stellt sie her – solange die Nazis ihn lassen.
Unser Experte, Björn Berghausen, ist Historiker und Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs.
---
17.12. Die österreichisch-schwedische Physikerin Lise Meitner ist an der Entdeckerinnen der Kernspaltung beteiligt.
Die österreichisch-schwedische Physikerin Lise Meitner war eine der Entdeckerinnen der Kernspaltung. 1917 wurde Meitner Professorin am "Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie". 1938 floh sie vor den Nazis. Die Leistungen der Frau jüdischer Herkunft waren lange vergessen.
Unser Experte, Wolfgang Pfaffenberger, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Volkswirt und Energieexperte.
---
18.12. Das erste Pergamonmuseum ist auf Sand gebaut – und wird abgerissen.
Das erste Pergamonmuseum musste schnell einem Nachfolgebau weichen. Es wurde Opfer des schwierigen Berliner Baugrunds – und der Erfolge der Archäologen, die so viel Monumentalobjekte fanden, dass das neue Museum schnell zu klein wurde.
Unsere Expertin, Eva Rothkirch, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Bibliothekarin an der Staatsbibliothek Berlin und Autorin.
---
19.12. Der Autor und Archivar Ernst Fidicin gründet den Verein für die Geschichte Berlins.
Ernst Fidicin, der wichtigste Gründervater des Vereins für die Geschichte Berlins, stirbt. Er war Autor und erster hauptamtlicher Archivar der Stadt Berlin.
Unser Experte, Manfred Uhlitz, Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Kunsthistoriker.
---
20.12. Alexander von Humboldt hält seine umjubelten Vorlesungen für das interessierte Berliner Publikum.
Ende 1827 hält Alexander von Humboldt umjubelte Vorlesungen – erst an der Universität und an der Singakademie in Berlin. Das gebildete Publikum will aus erster Hand von seinen Reisen und Forschungsergebnissen erfahren.
Unser Experte, Joachim Brunold, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Historiker und Autor.
---
21.12. Der damalige Direktor der Stadtmuseums kauft die Silbergegenstände, die Juden und Jüdinnen abgeben mussten.
1939 mussten die jüdisch-stämmigen Deutschen alle Wertgegenstände abliefern. Silberne Löffel, Bettelarmbänder, Kinderklappern . Ein ehemaliger Direktor der Stadtmuseums konnte einige Stückevor dem Einschmelzen retten. Doch sie stammen aus den pseudolegalen Zwangsabgaben.
Unsere Expertin, Elina Miagkovaitė, ist Sammlungsleiterin des „Silber-Sonderinventar“.
---
22.12. In der Zusammenführung der West- und Ostberliner Polizei gibt es Tage im rechtsfreien Raum.
Nach der Wiedervereinigung musste viele Institutionen zusammengeführt werden. Darunter die West- und die Ostberliner Polizei. Für ein paar Tage gab es einen rechtsfreien Raum in beiden Teilen der Stadt.
Unser Experte, Dietmar Peitsch, Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, ist Jurist und Autor.
---
23.12. Der „Hartung“-Stein soll mit Sonnenrad und Irminsul an die germanischen Wurzeln der NS-Bewegung erinnern.
In Berlin-Zehlendorf wird der acht Tonnen schwere „Hartung“-Stein eingeweiht. Mit Sonnenrad und Irminsul sollte an die germanischen Wurzeln der NS-Bewegung erinnern. Heute steht er zusammen mit anderen Denkmäler, die aus dem öffentlichen Raum entfernt wurden, in der Zitadelle Spandau – historisch eingeordnet.
Unser Expertin, Urte Evert, ist Museumsleiterin der Zitadelle in Berlin-Spandau.
---
24.12. Der Protagonist des "Neuen Bauens und geniale Stadtplaner Bruno Taut stirbt in Istanbul.
An Weihnachten 1938 stirbt Bruno Taut in Istanbul. Er baute die "Hufeisensiedlung" und die Waldsiedlung "Onkel Toms Hütte". Er war ein Protagonist des "Neuen Bauens", er verband einen sozialreformerischen Ansatz mit seiner Liebe zur Farbe und zur Natur.
Unser Experte, Christian Fessel, ist Regie-Kameramann und Stadtführer.
---
25.12. - 1: Der deutsch-jüdische Verleger und Kinopionier Karl Wolffsohn bekommt seine „Lichtburg“ nach der Arisierung nie wieder.
Der deutsch-jüdische Verleger und Kinopionier Karl Wolffsohn hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die „Lichtburg“, ein Kino mit 2000 Sitzplätzen, Festsälen, Restaurants, Bars und Cafés, und die „Gartenstadt Atlantic" konzipiert. 1939 musste er den Betrieb im Zuge der „Arisierung“ abgeben.
Unser Experte, Michael Wolffsohn, ist Historiker, Publizist und Enkel Karl Wolffsohns.
25.12. - 2: Die Gartenstadt Atlantic überlebt als eines der wichtigsten Beispiele des „Reform-Wohnungsbaus“ im Gesundbrunnen.
Die Gartenstadt Atlantic hat als eines der wichtigsten Beispiele des „Reform-Wohnungsbaus“ überlebt. Die Zeiten der deutschen Teilung waren schwierig, doch Stück für Stück ist dir Gartenstadt – fast – im alten Glanz wiedererstanden. Mit neuen Konzepten
Unser Expertin, Rita Wolfssohn, ist Vorständin der Gartenstadt Atlantic AG
---
26.12. Die Kunstfreunde im preußischen Staat bilden sich und sind die ersten bürgerlichen Mäzenaten.
Am 2. Weihnachtsfeiertag 1828 trifft sich der Vorstand Kunstfreunde im preußischen Staat. Wilhelm von Humboldt, Schinkel, Beuth, Rauch, Tieck und Carl Knoblauch gehören dazu. Aufgabe des Vereins sind die Auseinandersetzung mit hoher Kunst und bürgerliches Mäzenatentum.
Unser Experte, Jan Mende, ist Ausstellungsmacher und Kurator des Museums Knoblauchhaus.
Ruhmlose Helden - Ein Flugzeugabsturz und die Tücken deutsch-russischer Verständigung
Autorin des Films ist unser Vorstandsmitglied Ilona Wuschig
Am 6. April 1966 stürzte ein sowjetischer Jagdbomber in den West-Berliner Stößensee. Die Lesung rekonstruiert die dramatischen Ereignisse, die damals die Weltöffentlichkeit in Atem hielten und zeigt, wie die Erinnerung daran bis heute nachwirkt. Die beide Journalisten Gesine Dornblüth und Thomas Franke nehmen uns mit an die Schauplätze des Geschehens und erzählen von großem Mut und kleinen Missverständnissen.